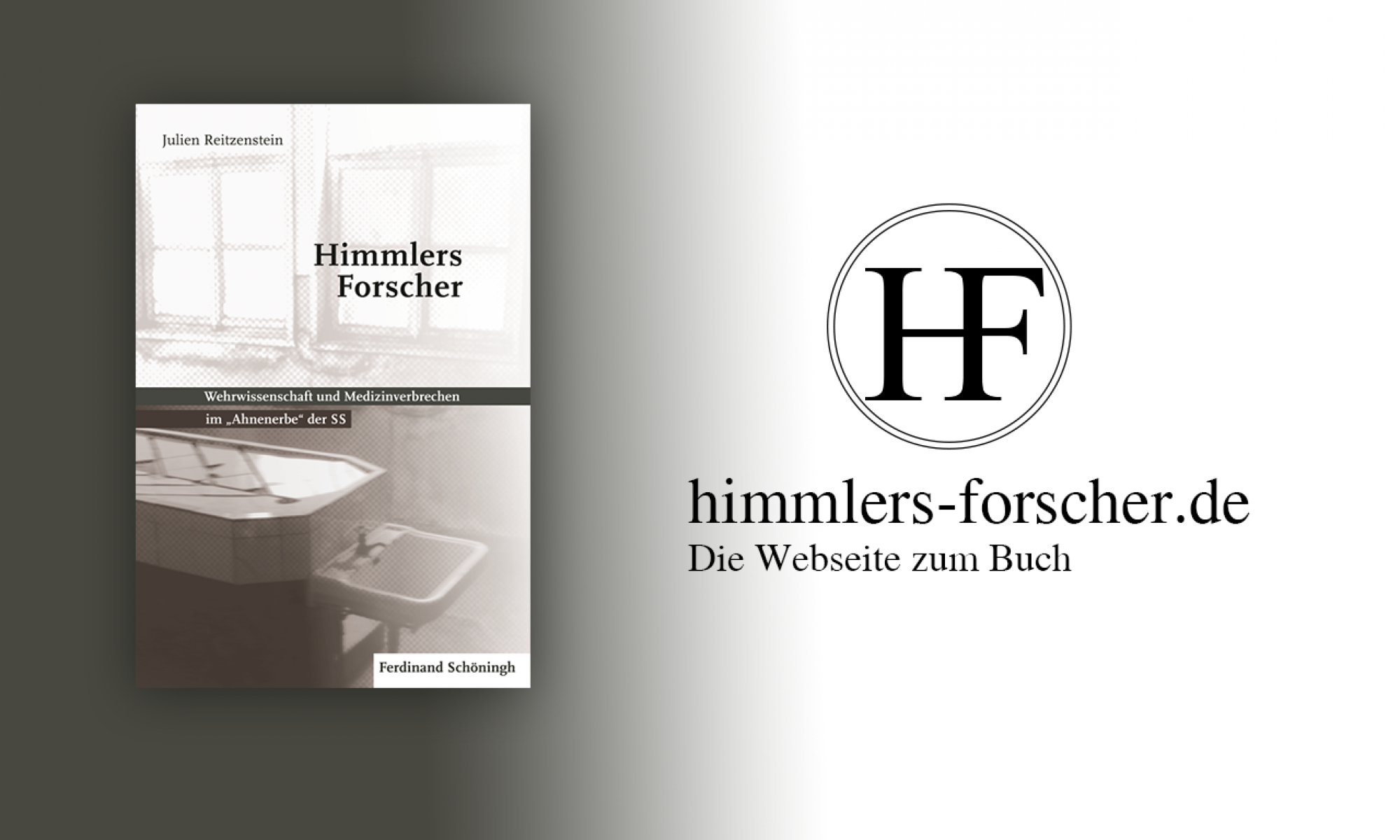Julien Reitzenstein legt mit „Himmlers Forscher“ die erste Monographie über das 1942 aus dem „Ahnenerbe“ der SS hervorgegangene Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung vor, dessen eingehende Erforschung im Grunde unverständlich lange ein Desiderat geblieben ist. Die Studie erscheint vierzig Jahre nach der „Ahnenerbe“-Pionierarbeit von Michael Kater, die den bis dato genauesten Blick hinter die Kulissen dieser Einrichtung ermöglicht hat, unter deren Regie mehrere der grausamsten NS-Wissenschaftsverbrechen organisiert worden sind.
Rezension von Richard Kühl, Eberhard Karls Universität Tübingen
Die Arbeit kann auf eine Vielzahl bisher nicht ausgewerteter Quellen zurückgreifen, die es ermöglichen, die mit Kriegsbeginn einsetzende Verlagerung der Schwerpunkte des ursprünglich völkisch-geisteswissenschaftlich ausgerichteten „Ahnenerbes“ auf den Sektor der Medizinforschung konzise nachzuzeichnen und zum ersten Mal die tatsächliche Ausdehnung des bei Kriegsende zehn Forschungsabteilungen umfassenden Instituts für wehrwissenschaftliche Zweckforschung sichtbar zu machen. Die Studie versteht sich in erster Linie als ein Beitrag über die NS-Funktionselite der „zweiten Reihe“, die der Führung – in diesem Fall: Himmler – eigeninitiativ „entgegen arbeitete“, d. h. in der Planung, der Organisation und beim „Netzwerken“ weitgehend selbstständig agierte und dabei eine erhebliche Dynamik entriegelte.
Der Schwerpunkt der Untersuchung liegt damit weniger auf den von den involvierten Forschern
und Funktionären begangenen Verbrechen, wenngleich Reitzenstein durchaus Neues zu Tage fördert: Die Opfer der Lost-Versuche im KZ Natzweiler werden erstmals namentlich identifiziert,
und auch der Tathergang zum Verbrechen der „jüdischen Schädel- und Skelettsammlung“ für die Reichsuniversität Straßburg wird präziser als bisher rekonstruiert. Vielmehr geht es Reitzenstein um den diesen und anderen Verbrechen gleichsam vorgelagerten Handlungsrahmen: um die institutionellen Strukturen, in denen sich die Akteure bewegten, die sich hieraus generierenden Entscheidungsprozesse und die Mechanismen der Expansion auf der institutionellen Ebene.
Reitzenstein arbeitet sehr nah an den Quellen, was weitergreifende Perspektiven mitunter in den Hintergrund treten lässt. Das gilt etwa für eine nähere Einordnung in die Entwicklungslinien der deutschen Wehrwissenschaften und für das in den letzten Jahren im Zusammenhang mit den NSMedizinverbrechen vieldiskutierte, in der Studie etwas zu sektoral behandelte Verhältnis zwischen parteiamtlichen Stellen, dem universitären Wissenschaftsbetrieb und dem Heeressanitätswesen. Aber der Zugriff überzeugt mit Blick auf die zentralen Fragestellungen durchaus.
Die Untersuchung changiert zwischen einer strukturanalytischen Darstellung des Ausbaus des Instituts und seiner netzwerkartigen Verflechtungen, einzelbiographischen Charakterstudien über entscheidende Akteure und einem lexikalisch angelegten Versuch der Gesamtrekonstruktion (Ausgreifen auf den universitären Betrieb, Finanzierung, Personal).
Julien Reitzenstein findet überdies ein Untersuchungsfeld vor, auf dem sich die von der „zweiten Reihe“ ausgehenden dynamischen Prozesse im polykratischen System des Nationalsozialismus in geradezu prototypischer Form beobachten und analysieren lassen. Der Autor veranschaulicht dies insbesondere an Wolfram Sievers. Der „Ahnenerbe“-Geschäftsführer wird als Typus des „Schnittstellenmanagers“ eingeordnet, dem es einerseits gelang, dem SS-Institut einen autarken Status im Organisationsgefüge des „Ahnenerbe“ und gegenüber weiteren Konkurrenzeinrichtungen zu verschaffen und sich andererseits selbst in einflussreiche Ämter (Reichsforschungsrat) zu bringen. 1944, so kann die Studie zeigen, war der gelernte Verlagskaufmann zum faktischen Chefkoordinator der wehrmedizinischen Forschung des „Dritten Reichs“ avanciert.
Ingesamt löst die gewählte Form der Nahaufnahme nicht nur den selbstgestellten Anspruch ein, der weiteren Forschung ein „Kompendium“ zum Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung zur Verfügung zu stellen. Durch die Analyse der dynamischen Infrastruktur und die Identifizierung der wesentlichen Akteure gelingt es darüber hinaus, Schneisen durch das Dickicht der Polykratie zu schlagen und aus diesem Blickwinkel die Enthegung der deutschen Wehrmedizin zu durchleuchten.
© Franz Steiner Verlag, Stuttgart
Zum Rezensenten:
Dr. Richard Kühl ist Habilitand und wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institut für Ethik und Geschichte der Medizin der Eberhard Karls-Universität Tübingen,
Lehrbeauftragter am Seminar für Zeitgeschichte der Universität Tübingen und Mitglied der Redaktion des „Portals Militärgeschichte“.
Erschienen in:
Juli 2015 – Vierteljahrschrift für Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, 102. Band, Heft 3 (2015) S. 385 f.