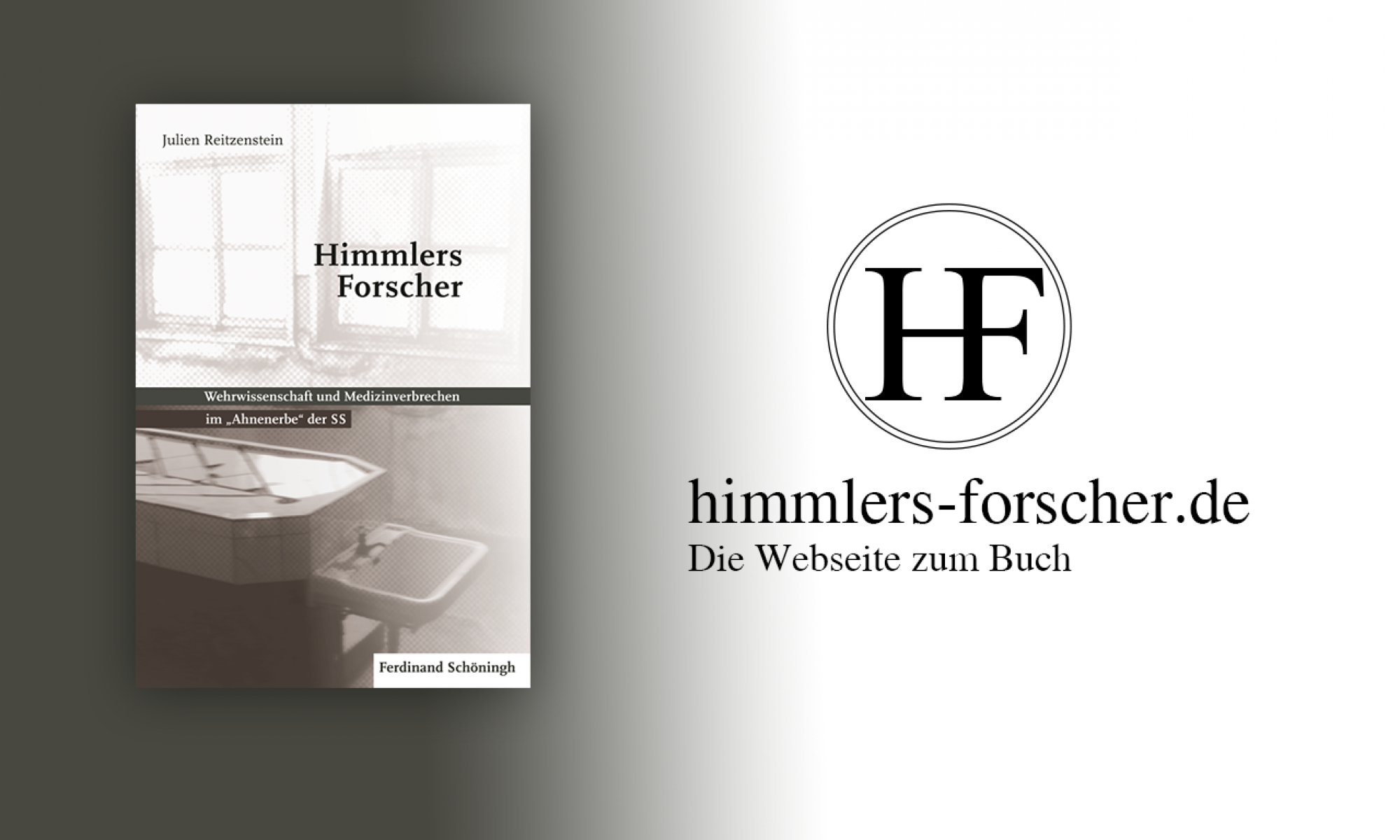Die jüdischen Voreigentümer der Dienstvilla des Bundespräsidenten – neue Erkenntnisse zu einem belasteten Gebäude und Gedanken zu präventivem Umgang mit möglichen PR-Problemen.
Beistellrezension vom 1. September 2014 in Haufe | Immobilienwirtschaft
Das Land Berlin hatte Anfang der 1980er Jahre das Gemälde „Straßenszene“ von Paul Ludwig Kirchner aus seriöser Quelle gekauft. In den 1920er Jahren hatte das Bild dem Schuhfabrikanten Alfred Hess gehört. Dessen Witwe verkaufte es nach der Machtübernahme der Nationalsozialisten an den privaten Kölner Kunstverein. Dieser verkaufte es weiter und dann hing es für Jahrzehnte im Brücke-Museum in Berlin. Eine banal scheinende Geschichte um ein berühmtes Bild. Doch Alfred Hess und seine Frau waren jüdischen Glaubens. Das Land Berlin gab auf eine erste Anforderung einer Nachfahrin von Alfred Hess das Bild ohne intensive Provenienzforschung mit Hinweis auf das Washingtoner Abkommen rasch heraus. Dieses Abkommen verpflichtet die Bundesrepublik bei Rückgabeansprüchen nach einer fairen Lösung für die Beteiligten zu suchen, auch wenn alle Ansprüche de iure verjährt sind. Diese sogenannte Causa Kirchner war und ist bis heute umstritten.
Der Kunst-Erbe Cornelius Gurlitt hatte unter seinen vielen Kunstwerken einige, die möglicherweise jüdischen Voreigentümern verfolgungsbedingt entzogen wurde. Das kann bedeuten, dass der Voreigentümer gezwungen wurde, zu billig zu verkaufen oder auch, dass er gar kein Geld erhalten hat. Nach Meinung von Juristen war jedoch – Jahrzehnte nach Verjährungsende – beinahe aussichtslos zu beweisen, dass Gurlitt konkretes Wissen über möglichen Kunstraub hatte. Dennoch verpflichtete ihn der öffentliche Druck dazu, einer Rückgabe zuzustimmen, auch im Falle verjährter Ansprüche. Cornelius Gurlitt hatte nicht als Staat das Washingtoner Abkommen unterzeichnet und dennoch die Maximalforderung auf Rückgabe erfüllt. Nun war Gurlitt ein eremitisch lebender Privatmann, der selbst für aggressivste Krawalljournalisten nur wenig zum Feindbild taugte – weder hatte er als Unternehmer von „Ausbeutung“ profitiert, noch als Nebenberufs-Börsianer Millionen an Steuern hinterzogen, noch konnte man ihn in die Nähe von Kaufhausmanagern mit Yacht- und Jet-Nutzung bringen. Man stelle sich das mediale Echo vor, wenn die Bilder sich nicht in der Wohnung eines Greises befunden hätten, sondern in einer Manager-Villa in Saint-Tropez oder einem Fond-Anbieter-Büro in Troisdorf.
Das Gewissen und die Moral – und die öffentliche Entrüstung – sind scharfe Schwerter. Sie vermögen Bilanzergebnisse ebenso wie Reputation zu zerschneiden. Nun können private und institutionelle Eigentümer Kunstwerke vergleichsweise einfach zurückgeben. Denn auch wenn keine rechtliche Verpflichtung besteht, so ist doch eine solche Gewissensentscheidung ein Beleg der Empathie für die Voreigentümer, die unter zumeist entsetzlichen Umständen ihr Eigentum und oft auch noch ihr Leben verloren. Dabei ergibt sich die steuerlich relevante Frage, wie solch eine Rückgabe, die ein Vermögensabfluss in oft erheblichem Ausmaße ist, von den Finanzgerichten behandelt wird. In der öffentlichen Meinung ist – gerade bei jenen vermögenden Eigentümern, die auf gute PR angewiesen sind – eine Rückgabe auch über die Moral hinaus bei Abwägung des Reputationsschadens die günstigere Alternative.
Da man mit Bildern keine Einkünfte erzielt, wird auch niemand fordern, diese irgendwem bei einer Rückgabe zu erstatten. Die Rückgabe ist Geste – und Vermögensabfluss – genug, um Verantwortung und Empathie zu zeigen.
Bei Immobilien ist die Sache anders. Wer heute eine – möglicherweise prominente – Immobilie im Portfolio hat, deren Eigentümer billig an einen Nationalsozialisten verkaufte und anschließend von der Gestapo ermordet wurde, gerät rasch in missliche Situationen. Auch wenn die Immobilie gutgläubig erworben wurde und keinerlei Rückgabeansprüche bestehen, steht die Frage im Raume, wieviel Profit mit Mieteinnahmen nur deshalb zustande gekommen ist, weil ein Verfolgter sein Leben verloren hat.
Profite durch Mieteinnahmen werden nicht diskutiert, wenn eine Liegenschaft in öffentlicher Hand ist. Dann jedoch besteht eine besondere Verantwortung für den Umgang mit dem Erbe zweier totalitärer Regime im Deutschland des 20. Jahrhunderts. Es ist Staatsraison, das erlittene Unrecht der Opfer des Nationalsozialismus nicht verblassen zu lassen. Jedoch muss sich in diesen Tagen das oberste Amt im Staate mit genau diesen Fragen auseinandersetzen. Die Bundesrepublik Deutschland stellt dem Bundespräsidenten eine Dienstvilla im vornehmen Berlin Dahlem zur Verfügung, dessen Geschichte gerade öffentlich wird.
Nach der Abdankung Wilhelms II. wurde dessen Domäne Dahlem im Berliner Süden parzelliert. Der Bebauungsplan sah ausschließlich herrschaftliche Villen auf parkähnlichen Grundstücken vor. Eines der Grundstücke lag in der Pücklerstraße 14. Das Vermögen des ersten Eigentümers wurde von der Hyperinflation stark dezimiert und die Baukosten ruinierten ihn, so dass er sich in der beinahe fertigen Villa im Jahre 1926 erschoss. Die Liegenschaft wurde dann von Hugo Heymann gekauft. Der jüdische Kaufmann aus Mannheim war mit Herstellung und Vertrieb von künstlichen Perlen zu Vermögen gekommen und hatte bereits Immobilien in Mannheim und Köln. Er zog mit seiner Frau Maria in die Villa. Alle angrenzenden Nachbargrundstücke gehörten Rudolf Löb, dem Chef der Mendelsohn-Bank, Generalkonsul, Berater mehrerer Weimarer Kabinette und anerkannter Finanzfachmann. Doch dieser guten Nachbarschaft war keine lange Dauer beschieden. Ende 1932 besuchte Maria Heymann den ehemaligen Innenminister Wilhelm Sollmann im Reichstag. Nach dem Kriege beschrieb dieser – inzwischen als Hochschullehrer in den USA lebend und dort die Regierung beratend – wie sich Maria Heymann vor dem brutalen Habitus der vielen Träger brauner und schwarzer Uniformen fürchtete. Sollmann sagte ihr voraus, dass diese Leute sehr bald an die Macht kämen und Heymanns als Juden „schreckliche Zeiten“ bevorstehen würden. Er riet, möglichst viel Vermögen flüssig zu machen, um flexibel reagieren zu können. Heymanns planten daraufhin die Auswanderung nach Norwegen. Die Villa in Dahlem wurde an einen Parteigenossen zu einem bemerkenswert günstigen Preis verkauft. Dieser war Verleger und die letzte Ausgabe seiner Zeitung am 20.04.1945 – die Rote Armee war in Dahlem schon zu hören – trug die Schlagzeile: „Reichsminister Dr. Goebbels: ‚Treu und tapfer sein, das heißt Sieg!‘“ Nach dem Villenverkauf wurden auch Heymanns andere Liegenschaften „arisiert“. Heymanns zogen in das Hotel Savoy nahe des Kurfürstendamms, weil es für sie als Juden beinahe unmöglich war, eine Wohnung zu finden. Die Gestapo beschlagnahmte Hugo Heymanns Erlöse aus den Zwangsverkäufen aus dem Hoteltresor, holte ihn mehrfach ab und misshandelte ihn so brutal, dass er an seinen Verletzungen starb. Im Jahre 1951 führte Heymanns Witwe einen Restitutionsprozess vor dem Landgericht Berlin. Die Verfahrensbedingungen waren aus heutiger Sicht skandalös. Der beklagte Eigentümer hatte einen Zeugen – den Notar, vor dem der Verkauf beurkundet wurde. Das ehemalige NSDAP-Mitglied lebte seit Kriegsende in Buenos Aires und erklärte brieflich, dass er keinerlei Verfolgungssituation beim Verkauf bemerkt habe. Die Gutachter beider Parteien kamen zu unterschiedlichen Ergebnissen. Am Ende ging die Witwe des ermordeten jüdischen Voreigentümers der Pücklerstraße 14 leer aus. Die Erben des Verlegers verkauften die Liegenschaft in den 1960er Jahren an den Berliner Senat. Dieser gab sie weiter an den Bund, dem sie als Dienstvilla für Bundeskanzler Schröder diente. Anschließend wurde sie vom Bundespräsidialamt genutzt. Die Mitarbeiter der Liegenschaftsverwaltung prüften angeblich vor dem Einzug Schröders die Provenienz des Areals. Das Ergebnis der Prüfung fiel so aus, dass weder auf der Homepage des Bundespräsidialamts ein Hinweis auf die Verfolgungssituation zu finden ist, noch am Grundstück selbst oder auch nur am Straßenkarree. Dies wundert, da vor sehr vielen öffentlichen Gebäuden in Berlin Gedenkstelen mit deren Geschichte aufgestellt sind.
Doch nicht nur die Dienstvilla hat eine problematische Geschichte. Rudolf Löb, dessen Liegenschaften die Pücklerstaße 14 umschlossen, verlor seine Anwesen an eine der berüchtigtsten NS-Einrichtungen: Die Forschungseinrichtung „Ahnenerbe“ und ihr „Institut für wehrwissenschaftliche Zweckforschung“, hatten seit 1938 ihre Zentrale auf dem Straßenkarree. Von dort planten sie unter anderem ihre unmenschlichen Medizinversuche an Häftlingen. Es steht die Frage im Raume, weshalb die Bundesrepublik sich stets der Verantwortung für ihre Geschichte stellt, aber die Geschichte des Straßenkarrees, auf dem auch das Staatsoberhaupt untergebracht ist, bislang verschwieg.
Mit Blick auf die eingangs geschilderte Fragestellung wird sich eine angemessene Lösung finden lassen. Wäre die Liegenschaft Pücklerstraße 14 jedoch im Eigentum eines Unternehmens, das mit dem Gebäude Mieterträge erzielt, gäbe es die genannten Risiken, die durch eine rechtzeitige Befassung mit der Historie präventiv hätten ausgeräumt werden können. Insoweit unterstreicht das Beispiel der Dienstvilla des Bundespräsidenten nicht nur den Handlungsbedarf der historischen Erkundung von Liegenschaften, sondern zeigt eines deutlich:
Die Verfolgung von Menschen, die einer bestimmten Gruppe zugerechnet wurden, von Menschen, deren Meinung von der herrschenden Ideologie abwich und von Menschen, deren wirtschaftlicher Erfolg durch staatliche Repression vernichtet wurde, ist gerade einmal 70 Jahre her. Insoweit ist anzuregen, dass auch Unternehmen, die heute im Rahmen einer stabilen Rechtsordnung gedeihen, Gedenkarbeit unterstützen. Dabei ist die Erkundung des eigenen Portfolios nur ein erster Schritt.
Artikel im PDF auf Julien Reitzensteins Seite: